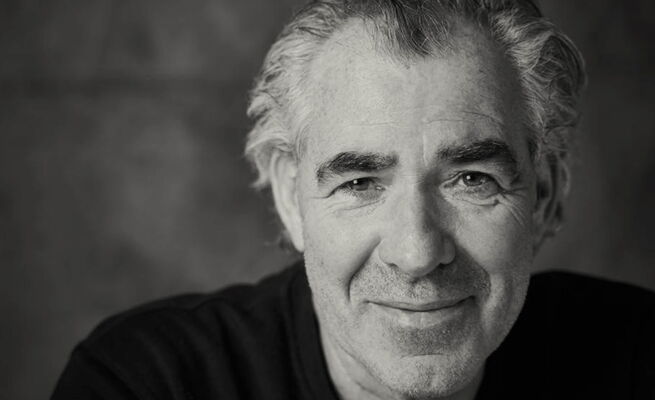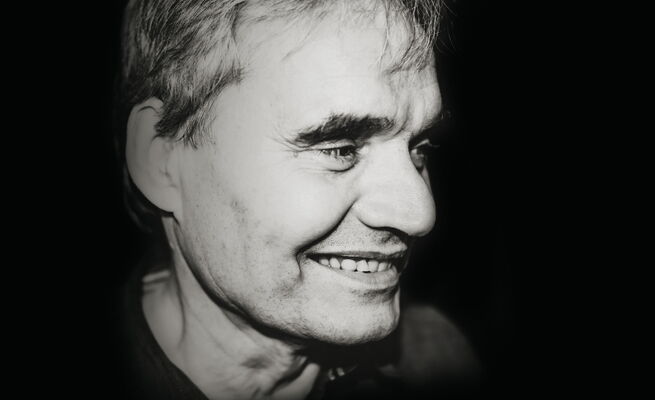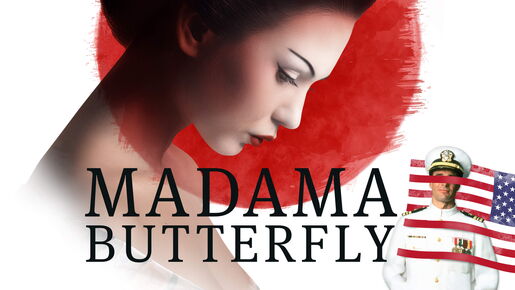
Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“ trägt den Untertitel „Tragedia giapponese“ – und diese Tragödie beginnt für die blutjunge Japanerin „Madama Butterfly“, als sie den Amerikaner Pinkerton kennenlernt: Sie wird dem Marineoffizier zu seiner Unterkunft bei Nagasaki gleich mit zur Verfügung gestellt. Die kleine „Frau Schmetterling“ fühlt sich zu dem schneidigen Militär hingezogen, der aber nimmt sie nicht wirklich als fühlendes Wesen wahr. Für ihn ist sie ein exotisches Abenteuer, sie wird zur Verschmähten und Verächteten.
Eine tragische Handlung ganz im griechischen Sinne, denn die Personen haben keine Wahl – sie müssen ihren vom Schicksal gezeichneten Weg bis zum Schluss gehen. Und das Publikum kann gar nicht anders, als mitzufühlen, mitzulieben und mitzuleiden. Puccinis kompositorisches Können hatte bereits mit „Madama Butterflys“ Vorgängerinnen "Tosca" und "La Bohème" das Publikum in seinen Bann geschlagen. Durch Puccinis intensive Auseinandersetzung mit der japanischen Musik und die Einflüsse von Wagners „Tristan“ erhält „Madama Butterfly“ bisher unbekannte Akzente. Puccini setzt zusätzlich Zitate aus anderen Stücken ein, die seine Oper für geübte Hörer mit Subtexten bereichern.
Puccinis Oper erlebte ihre Premiere 1904 in Italien, einer Zeit, in der sich die wirtschaftlich prosperierenden Industriestaaten dem asiatischen Raum weit überlegen fühlten. Ein Amerikaner in Nagasaki konnte sich daher gebärden wie eine Kolonialmacht persönlich. Diesen „Cultural Clash“ fängt Pucchini ein, indem er zwei musikalische Sphären aufeinandertreffen und neben den Referenzen an westliche Hörgewohnheiten auch fernöstliche Klänge in die Melodik einfließen lässt. Möglich wurde ihm das, weil er auf europäische Notensammlungen transkribierter japanischer Melodien zurückgreifen konnte.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Puccinis Meisterwerk bei den Eutiner Festspielen auf dem Programm steht: Erstmals wurde es 1999 aufgeführt. Zur 71. Saison im kommenden Sommer wird es zum zweiten Mal den Spielplan der Seebühne bereichern. Die Inszenierung in der italienischen Originalversion übernimmt Prof. Igor Folwill; die musikalische Leitung hat Hilary Griffiths.
Handlung
1. Akt
Der amerikanische Marineoffizier B. F. Pinkerton lässt sich in den Hügeln oberhalb von Nagasaki ein kleines Haus herrichten – ein Ort, an dem er während seines Aufenthalts in Japan ungestört leben und seine junge Geisha Cio-Cio-San treffen möchte. Für ihn ist die arrangierte „Ehe“ mit ihr ein unverbindliches Abenteuer, das nach amerikanischem Verständnis keinerlei Verpflichtung bedeutet.
Der US-Konsul Sharpless versucht Pinkerton vor den Folgen seines Leichtsinns zu warnen, doch der Offizier nimmt die Bedenken nicht ernst. Er sieht die Verbindung als exotisches Spiel und denkt bereits an eine spätere „richtige“ Hochzeit in seiner Heimat.
Für die 15‑jährige Cio-Cio-San hingegen ist die Eheschließung ein Wendepunkt ihres Lebens. Sie stammt aus einer angesehenen, aber verarmten Familie und glaubt fest an eine gemeinsame Zukunft mit Pinkerton. Aus Liebe wendet sie sich sogar vom Glauben ihrer Vorfahren ab und wird Christin – ein Schritt, der dazu führt, dass ihre Verwandten sie verstoßen. Pinkerton ist von ihrer Hingabe überfordert, doch er genießt die Zuneigung seines „Schmetterlings“, ohne die Tragweite seines Handelns zu begreifen.
2. Akt
Drei Jahre sind vergangen. Pinkerton ist längst nach Amerika zurückgekehrt, doch Cio-Cio-San wartet unbeirrbar auf seine Rückkehr. Gemeinsam mit ihrer treuen Dienerin Suzuki hält sie das Haus instand und kümmert sich um ihren kleinen Sohn, den Pinkerton nie gesehen hat.
Für Cio-Cio-San ist klar: Sie ist Pinkertons Ehefrau, und sie ist – zumindest in ihrem Herzen – Amerikanerin. Deshalb lehnt sie den Heiratsantrag des wohlhabenden Fürsten Yamadori entschieden ab.
Als Konsul Sharpless mit einem Brief Pinkertons erscheint, steigert das ihre Hoffnung ins Unermessliche. Sharpless erkennt entsetzt, dass Pinkerton nichts von seinem Kind weiß – und dass er inzwischen in den USA eine neue Ehe eingegangen ist. Doch er bringt nicht den Mut auf, Cio-Cio-San die Wahrheit zu sagen.
In freudiger Erwartung bereitet sie das Haus für Pinkertons Rückkehr vor, legt ihr Hochzeitskleid an und verbringt die Nacht am Fenster, überzeugt davon, dass ihr Geliebter jeden Moment erscheinen wird.
3. Akt
Am Morgen trifft Pinkerton tatsächlich ein – begleitet von Sharpless und seiner amerikanischen Ehefrau Kate. Cio-Cio-San hat die Nacht durchwacht und ist vor Erschöpfung eingeschlafen. Suzuki empfängt die Gäste und erfährt den wahren Grund ihres Besuchs: Pinkerton möchte seinen Sohn mit nach Amerika nehmen.
Als Pinkerton erkennt, wie treu Cio-Cio-San all die Jahre auf ihn gewartet hat, überkommt ihn Reue. Doch statt sich der Situation zu stellen, flieht er beschämt.
Cio-Cio-San tritt ein und sieht Kate. In diesem Moment begreift sie alles. Mit großer Würde erklärt sie sich bereit, ihr Kind zu übergeben – aber nur Pinkerton selbst soll es abholen.
Sie verabschiedet sich liebevoll von ihrem Sohn und bittet um einen Moment allein. Dann folgt sie dem Weg, den einst ihr Vater gewählt hat, und nimmt sich das Leben. Als Pinkerton zurückkehrt, ist es zu spät: Sein „Schmetterling“ ist für immer verstummt.
Besetzung
Cio-Cio-San: Tetiana Miyus, Yitian Luan
Suzuki: Viola Zimmermann, Wioletta Hebrowska
Pinkerton: Timothy Richards
Kate Pinkerton: Juliana Curcio, Ana Vidmar
Sharpless: Gerard Quinn
Goro: Tae Hwan Yun
Fürst Yamadori: John Heuzenroeder
Onkel Bonze: Valentin Anikin
Kaiserlicher Kommissar: Max van Wyck, Lovro Kotnik
Standesbeamter: Thomas Bernardy
Cio-Cio-Sans Mutter: Annika Egert
Ein Kind: Piet Schuppe
Statisterie: Kian Jali / Malcolm Lourenco
Informationen
Inszenierung: Prof. Igor Folwill
Musikalische Leitung: Hilary Griffiths
Kostümbild: Martina Feldmann
Bühnenbild: Jörg Brombacher
Licht: Rolf Essers
Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann
Regieassistenz/Inspizienz: Susanne Niebling
Chorleitung: Sebastian Borleis
Korrepetitor: Francesco de Santis
Ton: Christian Klingenberg
Maske: Marlene Girolla-Krause
Requisite: Hans W. Schmidt
Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)
Chor: Chor der Eutiner Festspiele
Aufführung in italienischer Sprache.
Dauer: 1. Akt: 60 Min, 2.+3. Akt: 90 Minuten
Pause nach dem 1. Akt: 30 Minuten
Besetzung
Künstlerisches Team
Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.