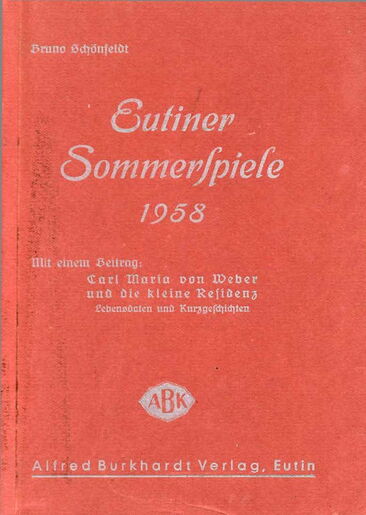
Ein halbes Jahrhundert vor Verdi vertonte Otto Nicolai, Kapellmeister an der Kgl. Oper Berlin, Shakespeares Lustspiel. Die Oper, die über ihren biedermeierlichen Stil hinaus in ihren edlen Melodien und ihrem romantisch-kapriziösen Zauber den Einfluss Mozarts und Webers erkennen lässt, wurde im Jahre 1849 in Berlin uraufgeführt, wenige Wochen vor dem Tode des 39jährigen Komponisten.
Die Handlung
1. Akt
Zwei Ehefrauen in Windsor, Frau Reich und Frau Fluth, erhalten von dem „gewichtigen“ und großsprecherischen Ritter Sir John Falstaff gleichlautende Liebesbriefe und beraten, wie sie dem komischen Schürzenjäger, zugleich aber auch dem eifersüchtigen Herrn Fluth einen Streich spielen können. Die Ehemänner kommen hinzu, ferner zwei Bewerber um die Tochter Anna Reich, Junker Spärlich, der vom Vater, und der vermögende Dr. Cajus, der von der Mutter begünstigt wird, während Anna selbst den armen Fenton liebt. Am Abend erscheint der dicke Ritter auf Einladung von Frau Fluth, doch wird das Stelldichein jäh unterbrochen durch Frau Reich, die die unerwartete Rückkehr des Herrn Fluth ankündigt. Rasch wird Falstaff in einen unbequemen Wäschekorb gepackt, den die Frauen in den Bach ausschütten lassen.
2. Akt
Im Gasthaus „Zum Hosenbande“, der ersten Szene des 2. Aktes, ertränkt Falstaff seinen Ärger im Wein, doch leuchtet ihm gleich die Sonne wieder durch einen Brief von Frau Fluth, der ihm ein neues Stelldichein in Aussicht stellt. Zu den fröhlichen Zechern, vor denen er von seinen Abenteuern prahlt, gesellt sich Herr Fluth, als „Bach“ getarnt, dessen Eifersucht aufs neue geschürt wird. – In der nächsten Szene, in Reichs Garten, kommen die reineren Gefühle der Jugend zur Geltung: Annas Freier treffen zusammen, aber nur der echte Liebhaber Fenton erreicht sein Ziel, während die beiden andern im Gebüsch versteckt bleiben. – Dann wieder der Kontrast dazu: Falstaff, bei Frau Fluth erneut aufgestört, wird diesmal in Frauenkleider gesteckt und dem eifersüchtigen Gatten als alte Muhme präsentiert; er wird von diesem zwar nicht erkannt, entgeht aber als Muhme nicht einer gehörigen Tracht Prügel.
3. Akt
Der 3. Akt sieht die Ehepaare einträchtig beisammen. Die lustigen Weiber schenken den Männern reinen Wein ein, und alle miteinander denken sich eine drastisch-spaßige Lektion für den liebesüchtigen Ritter aus. Wer aber Annas Gatte werden soll, darüber können Herr und Frau Reich sich noch nicht einigen. Bei einem Waldfest um Mitternacht wird Falstaff, als sagenhafter „Jäger Herne“ mit einem riesigen Geweih auftretend, in einem tollen Geisterspiel zur Ernüchterung gebracht, dann aber in den durch die heimliche Trauung Annas mit Fenton überraschten, am Ende fröhlich Hochzeit feiernden Kreis einbezogen.
Ein besonderer Reiz dieses Lustspiels liegt in seinem Lokalton. Von Windsor sehen wir den Park und das Wirtshaus zum Hosenband. Auf den Wiesen bleicht die Wäsche der Hausfrauen, unter den tiefhängenden Baumzweigen streifen die Rehe, und abends, wenn die Glühwürmchen leuchten, ziehen die Mädchen aus der Stadt heraus zu der unheimlichen Eiche, wo Falstaff, als der wilde Jäger verkleidet, der neckischen Frauen harrt. Dass die Landschaft in einem Stücke Shakespeares innerlich mitspielt, war zuerst im „Sommernachtstraum“ zu spüren: der Märchenwald zauberte Herzenswunder hervor. In den „Lustigen Weibern“ umfängt uns die Kleinromantik eines englischen Landstädtchens und gibt auch für die Fabel den poetischen Ton an.
Alois Brandl
Inmitten der ehrgeizigen Musikdramatiker seiner Zeit erschien ein Mann, Otto Nicolai (1810-1849), der ein Werk leichterer Art, ohne die stilistischen Unausgeglichenheiten schuf, die bei Marschner und Spohr gar zu offensichtlich sind. In diesem liebenswürdigen Werk erntet der Geist der Singspiels und der Wiener „Opera buffa“ seine letzten Triumphe, die zwar bescheiden, aber dennoch ihrer großen Tradition würdig sind. Nicolai belebte noch einmal die reizende Kombination der italienischen Oper mit dem deutschen Singspiel, die das späte 18. Jahrhundert so entzückt hatte. Seine „Lustigen Weiber von Windsor“ sind die einzige „deutsche Buffa“ in dieser Periode der düsteren Stoffe und vielleicht die einzige Oper, die versuchte, in Mozarts Fußstapfen zu treten. Bedauerlicherweise blieb sie ein Einzelfall.
Paul Henry Lang
aus „Music in Western Civilization“
Informationen
Komisch-phantastische Oper in 3 Akten
Komponist: Otto Nicolai
Librettist: Salomon Hermann Mosenthal
Uraufführung: 9. März 1849
Ort: Berlin
Spielstätte: Königliches Opernhaus
Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.