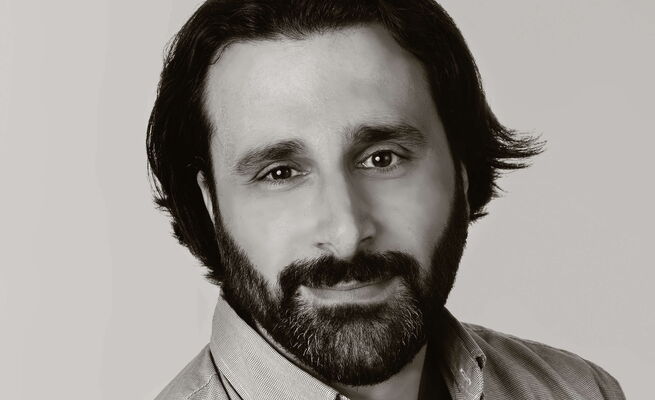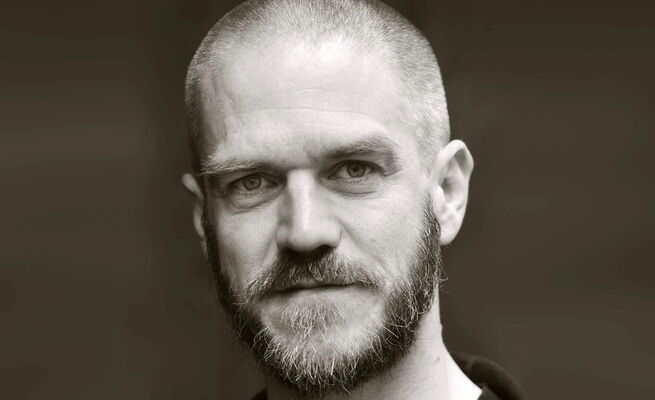DIE HANDLUNG
Als La Traviata 1853 erstmals auf die Bühne kam, löste Verdi einen Sturm der Entrüstung aus: Eine Oper, die das Schicksal einer Pariser Kurtisane ins Zentrum stellt, galt vielen als Provokation. Heute zählt das Werk zu den bewegendsten und meistgespielten Opern des Repertoires – ein musikalisches Drama über Liebe, gesellschaftliche Zwänge und den Preis persönlicher Freiheit.
1. Bild
In den Salons der Pariser Halbwelt feiert Violetta Valéry, trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit, ein glanzvolles Fest. Unter den Gästen befindet sich Alfredo Germont, der sie seit Langem bewundert und nun endlich die Gelegenheit erhält, ihr nahe zu kommen. Während die Gesellschaft ausgelassen feiert, spürt Violetta erneut die Schwäche ihrer Krankheit. Alfredo bleibt als Einziger bei ihr und gesteht seine Gefühle. Violetta ist berührt, aber auch verunsichert: Ein Leben der Hingabe und Treue scheint ihr unerreichbar. Dennoch lässt sie sich auf ein zartes Versprechen ein – ohne zu ahnen, wie sehr es ihr Leben verändern wird.
2. Bild
Monate später lebt Violetta mit Alfredo zurückgezogen auf dem Land. Für kurze Zeit scheint das Glück vollkommen. Doch die Idylle hat ihren Preis: Violetta finanziert das gemeinsame Leben heimlich durch den Verkauf ihres Besitzes. Als Alfredo davon erfährt, reist er nach Paris, um Geld zu beschaffen. In seiner Abwesenheit erscheint sein Vater Giorgio Germont. Er bittet Violetta eindringlich, Alfredo zu verlassen, um die Ehre der Familie zu wahren. Schweren Herzens erkennt sie, dass ihr Opfer notwendig ist – und entscheidet sich, Alfredo ohne Erklärung den Rücken zu kehren.
3. Bild
Am Abend eines großen Festes begegnen sich Alfredo und Violetta erneut. Sie erscheint in Begleitung des Barons Douphol, was Alfredos Eifersucht weiter anheizt. Geblendet von Wut und Verletzung demütigt er Violetta öffentlich. Die Situation eskaliert, und der Baron fordert Alfredo zum Duell. Die Tragödie nimmt ihren Lauf.
4. Bild
Violetta ist inzwischen schwer erkrankt und lebt verarmt und isoliert. Nur ihre treue Annina steht ihr noch zur Seite. Als Alfredo – inzwischen über die wahren Hintergründe aufgeklärt – zu ihr zurückkehrt, flammt in Violetta ein letzter Funke Hoffnung auf. Doch die Krankheit ist stärker. In Alfredos Armen findet sie schließlich Frieden, während die Musik Verdis ihren Abschied in ergreifender Schönheit zeichnet.
Informationen
Musikalische Leitung: Leo Siberski
Inszenierung: Dominique Caron
Bühnenbild: nach Entwürfen von Ursula Wandaress
Kostümbild: Martina Feldmann
Lichtdesign: Silvio Schneider
Choreographie: Olaf Reinecke
Chorleitung: Romely Pfund
Korrepetition: Francesco de Santis
Regieassistenz: Björn Reinke
Inspizienz: Peter Priegann
Künstlerisches Team
Weitere Mitwirkende
Technische Leitung: Rainer Stute Technische Beratung: Arend Knoop Bühnenmeister: Silvio Schneider Beleuchtungsmeister: Silvio Schneider / Ismael Schott Beleuchtung: Marvin Stahnke / Marcel Nimke / Christopher Riches Tonmeister: Christian Klingenberg Requisite: Hans W. Schmidt Bühnenmaler: Alp Arslan Tokat / Michael Baltzer / Frank Schmidt / Natalia Vottariello / Petra Schoenewald Bühnen- und Kulissenbau: Ole Kwiatkowski / Thomas Andersen / Tadek Pawelczak / Dietrich Witt / Jakob Brunken Leiterin Kostümabteilung: Martina Feldmann Schneiderei: Hildegard Baaske / Helena Belz / Tatjana Kleinmann / Kira Neller / Angelika Wallbrecht / Constanze Brunion Ankleider/-in: Eveline Flessau / Edgar Girolla Chefmaskenbildnerin: Marlene Girolla-Krause Maske: Gabriela Kunte / Merle Bracker / Susanne Koeck / Dörte Maas
Orchester KaPhiL!
Die Kammerphilharmonie Lübeck ist seit 2016 das Hausorchester der Eutiner Festspiele. Sie wurde von freischaffenden Musikern aus Norddeutschland gegründet mit dem Ziel, klassische Musik auf innovativen Wegen in unsere Zeit zu transportieren. Ihr Leitbild sind neue Klangräume in jeglicher Hinsicht. Neben der klassischen Musik von Bach bis Berio werden auch aktuelle Kompositionen, Soundtracks sowie Jazz, Pop, Rockwerke von verschiedenen Besetzungen realisiert und miteinander verknüpft. Die ständige Bereitschaft, alte Konzertformate mit Offenheit und Neugierde zu erweitern, ohne dabei den Respekt vor bewährten Traditionen zu verlieren, ist eine elementare Grundhaltung der Musiker. Sie bestimmen ebenso eigenverantwortlich mit über die Organisation, Probenkultur und Repertoireauswahl. Niemand aus dem Orchester soll seinen Part wie ein musikalischer Roboter abliefern müssen, sondern jedes Mitglied sich mit dem Ergebnis der gemeinsamen Klangarbeit identifizieren können. Das ist das erklärte Ziel, das der Schlagzeuger Andy Limpio und der Posaunist Helge Tischler mit ihrer Initiative zur Gründung der KaPhiL! verknüpften. Musikalisch befeuert werden die Musiker durch ihren Chefdirigenten Leo Siberski, der einen enormen Erfahrungshorizont aus allen Bereichen des Musikgeschäfts einbringt.
Violine 1: Markus Menke / Vahram Sardaryan / Wiltrud Menke / Svenja Lippert / Arsen Zorayan / Karoline Ott / Vera Marreck / Ivanna Ilina-Frolikov / Nora Schreckenschläger / Francisco Andrei Valerin Gomez / Hovhannes Partizpanyan / Nele Schmidt Violine 2: Enrique Alejandro Molina Redondo / Katharina Kowalski / Desheng Chen / Anita Swiatek / Hrant Arakelyan / Nele Schmidt / Maike Schmersahl / Ninela Lamaj Bratsche: Kevin Treiber / Lukas Schwengebecher / Aljona Wetrowa / Emilia Stępień / Anatol Markoni / Narine Zakharyan / Hye-Rin Rhee / Petra Marcolin Cello: Tine Schwark / Alonso Urrutia / Noelia Balaguer Sanchis / Alexandra Silina-Zaitsev / Monika Fughe / Natalie Hahn / Cem Cetinkaya Kontrabass: Till Baumann / Alf Brauer / Daniel Tolsdorf / Joanna Makarczuk / Lenard Liebert Flöte: Arevik Khachatryan / Anna Denise Rheinländer / Waldo Ceunen Oboe Johans Camacho Aguirre / Britta Just / Gonzalo Mejia Klarinette: David Arbeiter / Michael Elvermann Fagott: Markus Pfeiff / Sebastian Ludwig di Salvatore Horn: Karl Unger / Radek Zamojski / Juliusz Tkacz / Mana Tabata Trompete: Tobias Hain / Johannes Lugger Posaune: Moritz Löffler / Luka Stankovic / Felix Griese / Helge Tischler Tuba: Diego Armando Hernandez Cardona Schlagwerk: Julian Grebe / Jonathan Göring / Nils Grammerstorf Harfe: Janina Gloger-Albrecht
Der Festspielchor
Ein vielstimmiger, szenisch beweglich agierender Chor gehört zu den Markenzeichen der Eutiner Festspiele. Kein Wunder: Die Freilichtbühne am Großen Eutiner See ist aufgrund ihres natürlichen, offenen Klangraumes der ideale Spielort für Opern mit zahlreichen Solisten und vielen Chorpartien. Bei der Programmgestaltung ist jedes Jahr ein entscheidendes Kriterium, welchen Anteil der Chor in den zur Auswahl stehenden Werken hat. Der Anspruch, den Chor möglichst oft auf der Bühne in Aktion zu erleben, verlangt ein Höchstmaß an stimmlicher Präsenz und homogener Klangfarbe. Diese Anforderungen sind die Richtschnur bei der Besetzung der Stimmlagen im Chor, so dass ein Engagement bei den Eutiner Festspielen traditionell ein Gütesiegel für Chorsänger ist. Ebenso Tradition bei den Festspielen hat die Ergänzung des von Profis und Musikstudenten gebildeten Chors durch Laiensänger aus Eutin und Umgebung. Diese personelle Verbundenheit und das ehrenamtliche Engagement sorgen immer wieder für belebende Impulse rund um die Freilichtbühne. Dieser Extrachor, bei den Festspielen intern Eutiner Chor genannt, beginnt meist schon im Januar mit wöchentlichen Proben für die Partien der kommenden Spielzeit, bevor im Juni die Probenarbeit des gesamten Chors startet. Chorleiterin ist seit 2017 Romely Pfund.
Uta Preisinger / Kristina Struy / Anke Motz / Claudia Jahrke / Sylvia Kölle / Maren Baumeister / Claudia Bohrer-Rodriguez / Astrid Cordes / Anke Ellermann / Sabine Cyrus / Uschi Richert / Maike Werthen / Erwin Groke / Marco Schumann / Dr. Gerhard Lange / Karl-Winfried Bode / Sören Hand / Satoko Koiwa
Profis und Studenten: Lea Bublitz / Jasmin Delfs / Sebastian Malkowski / Juan Vi l lanueva / Jeremy Almeida-Uy / Chiaki Shimoji / Ayleen Gerull / Elisabeth Wöllert / Djordje Papke / Maxim Kurtsberg / Kasimir Krzesinski / Wolf Leichsenring / Jerzey Kwika / Masanori Hatsuse / Kerstin Auerbach / Thomas Bernardy
Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.