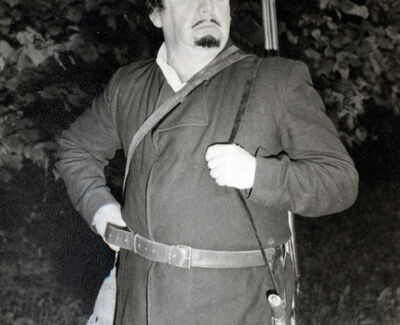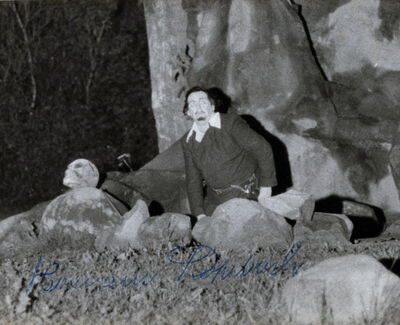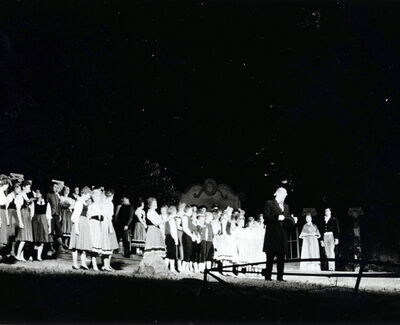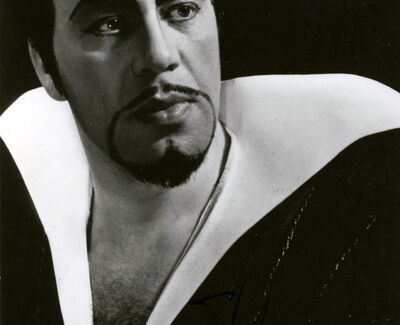Die Eingebung des „Freischütz“
Auf einer Reise nach Prag und durch den schönen, aber unheimlichen Böhmerwald mit seiner späteren Frau, der Sängerin Karoline Brandt, gelangte Weber nach abenteuerlichen Erlebnissen auf das Schloss des Freiherrn Ottokar von Schwarzenbrunn.
Den Nachmittag verbrachten sie in dem weit in die Wildnis vorstoßenden Park, der, ein einsames Kunstwerk, zwischen dem ersten Waldgebirge und der schlichten Landschaft der bäuerlichen Flur vermittelte...
Sie ruhten an einem mit Stein gefassten Brunnen. Ein empörtes Wappentier lechzte sie an. Schüchtern sprudelte der Springquell, der stoßende Wind warf die Tropfen sprühend über das Becken hinaus. „Wahrhaftig, Freiherr, Sie sind undankbar!“ rief Weber. „Ihr Besitz ist schön. Ein hesperisches Eiland! Und die schweigsame Wildnis dahinter mit den herrischen Bergen! Oh, heute fühle ich wie noch nie den Zweck des Lebens! Das All erschuf sich den Menschen, um sich durch dessen Seele hindurch an sich selber zu freuen.“
Aus den schweren Forsten herüber blies schwärmerisch ein Waldhorn.
„Mein Leibjäger bläst“, sagte der Freiherr. „Er ist ein sehr verliebter Bursch.“
„Wie herzlich rührt mich immer der Klang des Horns im Wald“, sprach Weber. „Der Wald erscheint mir als die wahre Wiege der Musik. Mit seiner grünen Wölbung gab er dem ersten Menschenlied den vollen Hall. Hornruf tönte schon zur Urzeit über die Wipfel hin. Dem Jagdgenossen zum Zeichen. Und ein Waldjäger war es, der das Saitenspiel erfand. Als er einmal den Bogen gegen das bange Wild spannte, hörte er zum ersten Mal die Sehne singen.“
Lange saßen sie in der Kühlung des hauchenden Brunnens. Der Kapellmeister war schweigsam geworden, und die Sängerin kehrte das Gesicht berghin, um den heimlich belagernden Blicken des Schlossherrn zu entgehen. Karoline begab sich zeitig zur Ruhe, sie wollte sich heute gründlich ausschlafen.
Der Kapellmeister aber wanderte in seinem Gemach auf und ab, ohne Sehnsucht nach Ruhe und das Herz seltsam bedrängt.
Er hörte die Uhr bedächtig ticken. Sie flüsterte: „Die – Zeit – ver – geht, – die – Zeit – ver – geht!“ Auf dem Goldgehäuse war in der schrägen Haltung eines Läufers, rennend und fliegend zugleich, Gott Chronos gebildet mit seinem schrecklichen Werkzeug, der Sense. Weber tat das Fenster auf. Schwarz lagerte das Gebirge. Die Sterne strömten. In der Ortschaft drunten läutete ein Dengelhammer. Ein Mäher rüstete sich für den Morgen, eine Ernte war reif.
Der Künstler fühlte jeden Dengelschlag wie den Schlag eines erwachenden Gewissens. „Und du?“ redete es. „Was hämmerst du? Wo erntest du? Was hast du den Tag über vollbracht? Wieder hast du einen Tag, einen vollen, schweren Tag, einen ungeheuren, niemals wiederkehrenden Teil deines Lebens versäumt und vertändelt!“
„Die – Zeit – ver – geht!“ lispelte es silbern. Wunderbar und wehmutsvoll durchwagte es den Mann. Aus wallendem Gefühl, aus dem Schmerz um die Welt, aus verdämmertem Erlebnis und ungewiss gewordenen Bildern formte es sich zum Klang. Aus tiefer, unendlicher Ahnung kündigte sich das künftige Werk an. Er hob den Arm, als wolle er in das Sternbild der Leier greifen.
Was bebte in ihm nach Gestaltung? Ein Gewitter? Eine süße Nachtmusik für sie, die jetzt bereits schlummerte? Eine düstere Sage? Eine Symphonie, dem schönen Garten gewidmet, der da unten im Rausch und Flut sich aufzulösen schien? Und war das Wonne, was ihn da bedrängte? War es Qual?
Es glomm und tönte, unsichtbare Saiten bebten, Hörner erschollen aus der fernsten Tiefe der Seele, die Wände des Raums sangen, von den Gestirnen sank es silbern hernieder, von überallher, aus Wesen und Unwirklichkeit flutete die Überfülle auf ihn ein. Wie das fassen? Wie das festhalten? Es kam. Woher? Es verglitt. Wohin? Es verscholl wieder in Vergessenheit. Oh, nur nichts vergessen, was in dieser Stunde der Gnade ihm geschenkt
Hans Watzlik
Informationen
Romantische Oper in 3 Akten
Komponist: Carl Maria von Weber
Libretto: Friedrich Joachim Kind
Uraufführung: 1821
Ort: Berlin
Spielstätte: Konzerthaus
Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.