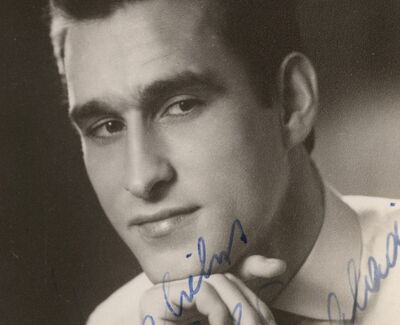Die Handlung
So schlicht und klar – und dennoch voll Spannung Friedrich Kinds „Freischütz“-Text ist, so verworren und voller Widersprüche ist das oft auf pathetischen Stelzen taumelnde Libretto des „Troubadour“. Verdis“ des Südländers leidenschafterfüllte Oper lebt aus ihren vielen, nicht immer begründeten Konflikten. Der großen Kunst eines erfindungsreichen Meisters gelingt es, die musikfreudigen Hörer ganz einzufangen, dass die „Banalität der Mache des Libretto“ sie kaum stört, auch wenn ihnen die Fabel in vielem verschlossen bleibt.
Sie sei kurz in ihren Hauptzügen erzählt:
I. Akt
Ferrando, Anhänger des Grafen Luna, hält Wache vor dem Grafenschloss. Graf Luna liebt die Palastdame Leonore, Gräfin von Sargasto. In einem Troubadour, der abendlich seine Minnelieder singt, ahnt er einen Nebenbuhler. Ferrando erzählt, um die schläfrigen Wachen munter zu halten, die spannende Vorgeschichte der Opern-Handlung: der verstorbene Vater des jungen Grafen verurteilte eine Zigeunerin, die sein krankes Kind behext haben sollte, zum Feuertod. Ihre Tochter Azucena raubte eines der beiden Grafenkinder, den kleinen Bruder des jetzigen Grafen Luna, um ihn, wenn die Mutter verbrannt würde, rächend ins Feuer zu schleudern.
Aber in furchtbarer Erregung warf sie irrtümlich statt des jüngsten Grafenkindes das eigene in die Flammen. Es glückte ihr, zu entkommen, und sie erzog den Grafensohn unter dem Namen Manrico als ihren eigenen.
Der alte Graf starb im Glauben, sein geraubter Sohn lebe, und verpflichtete den ihm verbliebenen, die Spur der Zigeunerin zu verfolgen. –
Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Aus dem als Zigeuner aufgewachsenen Grafensohn Manrico ist ein Troubadour, ein Anführer im Krieg gegen den Grafen Luna und (um die Verwirrung voll zu machen!) der begünstigte Liebhaber der vom jungen Grafen umworbenen Gräfin Leonore geworden. \
Park der Gräfin Leonore von Sargasto. – Dunkle Nacht. Leonore bekennt ihrer Vertrauten Inez ihre Liebe zum Troubadour Manrico („Es glänzte schon das, Sternenheer – „). Graf Luna hofft, die Geliebte hier zu treffen. Leonore hört Manricos Stimme und spricht Luna als den vermeintlichen Troubadour beglückt an. Aber im plötzlichen Mondlicht erkennt sie ihren Irrtum. Luna und Manrico kreuzen ihre Klingen, ohne dass eine Entscheidung erkennbar wird.
II. Akt
Zigeunerlager bei einer Schlossruine. – Nach einem Zigeunerchor schildert Azucena erregt ihrer Mutter Tod („Lodernde Flammen –“!) und berichtet (nun mit Manrico allein) das Furchtbare der Kinderverwechselung. Des aufhorchenden Manrico Bedenken, er sei also nicht ihr Sohn, verscheucht sie gewandt und erinnert ihn daran, wie mütterlich treu sie ihn, den im Kampf mit dem Grafen Luna Verwundeten, pflegte. Sie verpflichtet ihn, diesmal in einem Gefecht ihn nicht wieder zu schonen, sondern zu töten.
Ein Bote bringt ein Fürstliches Schreiben, in dem Manrico zum Kommandanten der durch den Grafen Luna gefährdeten Feste Kastellor ernannt wird, und erzählt, Leonore wolle, da sie Manrico für tot halte, ins Kloster gehen.
Klosterkreuzgang. – Auch Graf Luna erfuhr Leonores Absicht, den Schleier zu nehmen, und sucht mit seinen Mannen, es zu verhindern. Nonnenchor mit Leonore und ihrer Vertrauten Inez. Plötzlich taucht der tot geglaubte Manrico auf, Leonore: „0. Gott, ist's nur ein schöner Traum?“ (Leidenschaftliches Sextett!). Ruiz, Manricos Vertrauter, kommt ihm zur Hilfe. Lange stehen beide Nebenbuhler einander mit ihren Anhängern kampfbereit gegenüber. Leonore bekennt sich zu Manrico. Die Nonnen flüchten. Ferrando hält den wutentbrannten Grafen zurück – und gebietet Frieden.
III. Akt
Graf Lunas Feldlager vor der Feste Kastellor. – Chor der angriffsfreudigen Soldaten. Der Graf weiß, dass Leonore mit Manrico in der Feste ist. Die Zigeunerin Azucena wird herangeschleppt. Sie schwärmt von ihrer Heimat Biskaya und ihrem verschwundenen Sohn, den sie suche. Der Chor horcht auf und erzählt, dass dort vor 15 Jahren ein Grafensohn geraubt wurde: „Ich bin der Bruder des Geraubten.“ Ferrando: „Sie ist es, die das Kind ins Feuer warf!“ Sie wird mit dem Feuertod bedroht und abgeführt.
Saal in der Feste Kastellor. – Der Angriff der Belagerer wird erwartet. In die Todbereitschaft der Liebenden. Manrico und Leonore, klingen tröstende Orgelklänge aus der Kapelle herein. Ruiz meldet, dass man vor der Burg einen Holzstoß für eine Zigeunerin herrichtet.
Nun bekennt Manrico: „Ich bin ihr Sohn!“ und ruft seine Tapferen zur Hilfe zusammen („Lodernde Flammen! Mutter, du sollst nicht sterben! Oder ich sterbe mit dir!“). Kampfbereit mit Mannen ab!
IV. Akt. Am Palast des Grafen Luna, Turm mit Kerkerfenster. (Die Feste Kastellor ist gefallen, Manrico eingekerkert in des Grafen Hand.) – Finstere Nacht. Verhüllt kommen Leonore und Ruiz, ihn zu retten. Leonore: „0, mein Manrico, dir bleibt mein Herz!“ Zur Totenglocke lässt Verdi geheimnisvoll ein ergreifendes Miserere („Hab Erbarmen, Herr, mit einer Seele –!“) aufklingen. Manricos Stimme aus dem Verließ: „Schon naht die Todesstunde. Leonore, mein Glück, bis zum letzten Hauche bist du mir alles!“
Graf Luna kommt und befiehlt Manricos Tod und die Verbrennung der Zigeunerin. Leonore fleht: „Erbarmen!·' Graf: „Du bittest vergebens!“ Leonore: „Erbarmen! Ist er deiner Rache entflohen, dann bin ich dein!“ Während sie diese Worte beschwört, nimmt sie Gift, das in einem Ring verborgen war. („Befreit! 0, welche Seligkeit!“).
Kerker mit Manrico und Azucena. – Wieder erwachen in Azucena Erinnerungsbilder vom Feuertod ihrer Mutter. Sie weiß, dass ihr dasselbe bevorsteht. Liebevoll bemüht sich Manrico um sie: „Lass die Bilder entschwinden! – Schlafe!“ Im Halbschlaf träumt sie wieder von der friedevollen Heimat.
Leonore tritt ein: „Ich bringe Rettung!“ Sie erzählt ihr Gelübde. Manrico, der nichts von dem Gift weiß, zeiht sie, der Lieblosigkeit und Falschheit. Leonore: „Fliehe schnell! Ich liebe dich treu und wahr!“ Da beginnt das Gift zu wirken: „Ich trage den Tod im Herzen.“ Nun erkennt Manrico, was sie tat.
Der hereintretende Graf Luna erlebt Leonores Tod in Manricos Armen. Er befiehlt, Manrico zur Hinrichtung zu führen.
Die schlafende Azucena erwacht: „Wo ist mein Sohn –?“ Graf: „Zum Tode geführt.“
Azucena: „Er war dein Bruder. – Mutter, du bist gerächt!“
Graf Luna (verzweifelt): „Und – ich – lebe noch –?“
Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi, dessen leidenschaftliche, zum wirkungsvollen Überschwang neigende große Kunst fast ganz der Oper gehörte, wurde am 10. Oktober 1813 (auch Richard Wagners und Fr. Hebbels Geburtsjahr) in dem kleinen Dorfe Roncole (Parma, Oberitalien) als Sohne eines Gastwirts und Händlers geboren. Ein der Familie nahestehender wohlhabender Gönner, Barezzi, erkannte früh sein Talent und förderte dessen Entfaltung. Der 11-jährige Giuseppe wurde Organist in seinem Heimatdorfe.
Ein hervorragender Lehrer, Theaterdirigent der Mailänder Scala, leitete seine Ausbildung. 1836 wurde des jungen Komponisten erste Oper in Mailands berühmtem Opernhaus mit großem Erfolg aufgeführt.
Aber im Verlauf dreier Monate vernichtete der Tod 1840 sein junges Glück; er nahm ihm seine Gattin Margherita. Barezzis Tochter, und zwei Kinder. Dieses Erlebnis und seine Beteiligung an den Einigungsbestrebungen Italiens verlieh seinen Werken ihre strenge Herbheit. Der Zufall, dass die Anfangsbuchstaben des lombardischen Sehnsuchtsrufes „Vittorio Emmanuele, Re D‘Italia“ den Namen „V-E-R-D-I“ ergaben, steigerte seine Volkstümlichkeit.
1849 heiratete er die geniale Sängerin Giuseppina Strapponi. Bis nahe vor seinem Tode (27. Januar 1901) erlebte sie, als rechte Lebenskameradin dem unermüdlich Schaffenden verbunden, mit ihm das Glück (auch wohl Enttäuschungen!) seiner Erfolge. Nach der Oper „Rigoletto“, der ersten, die bleibend mit Verdis Namen verbunden war und ist, folgte 1853 „Der Troubadour“.
Zu seinen späteren unter Richard Wagners Einfluss geschriebenen Werken gehört auch die Oper „Othello“, die im Vorjahr mit dem ganzen Glanz ihrer Musik über die Bühne der „Sommerspiele“ ging.
Informationen
Oper in 4 Akten
Originaltitel: Il trovatore
Komponist: Giuseppe Verdi
Librettisten: Salvadore Cammarano, Leone Emanuele Bardare
Literarische Vorlage: El trovador von Antonio García Gutiérrez (1836)
Uraufführung: 19. Januar 1853
Ort: Rom
Spielstätte: Teatro Apollo
Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.